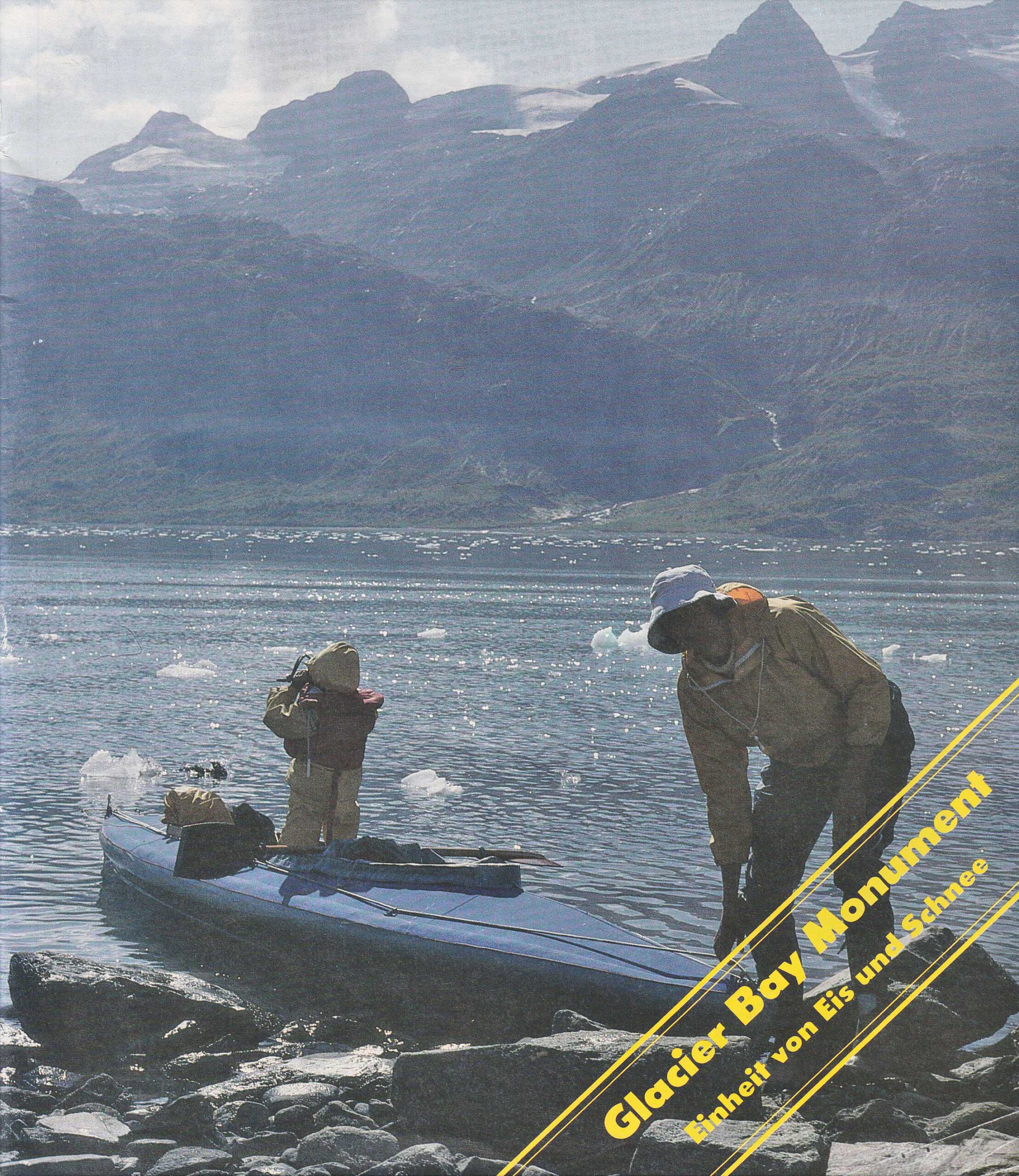Spuren im Paradies
Erinnerungen aus der Jugend
„Unser kleines Paradies“ – Diese Worte wollen mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Aber muss es gleich das Paradies sein, das hier herbei zitiert wird ?
Paradiese habe ich inzwischen viele erlebt:
Tierparadiese in Nationalparks und an einsamen Küsten, paradiesische Landschaften mit Palmen und Sonnenwetter, paradiesische Ruhe und Harmonie in Schäreninselwelten und paradiesische Traumstrände an vielen Orten, die wir bereisten.
Bei so vielen Paradiesen muss die Frage erlaubt sein: Was ist das Paradies?
Ich ziehe da lieber das Lexikon zu Rate: „Man hat sich daran gewöhnt, den „Garten in Eden“ als Paradies zu bezeichnen, der Ort, der nach dem ersten Buch Mose der Aufenthaltsort des ersten Menschenpaares bildete und der von einem Strom bewässert wurde, der sich bei seinem Austritt aus dem Garten in vier Arme teilte: Pischon, Gihon, Chiddekel (Tigris) und Phrat (Euphrat). Dadurch würde die alttestamentliche Darstellung das Paradies dahin verlegen, wo der noch von den klassischen Schriftstellern mit begeisterten Worten geschilderte Garten der alten Welt lag, nämlich auf den sogenannten Isthmus der Euphrat- und Tigrisniederung, in den Landstrich von Bagdad und Babel.“
Ob diese biblischen Angaben uns hier weiterführen?
Das Wort Paradies leitet sich nach meinem Lexikon von dem persischen Wort pardes ab, was so viel heißt wie Park.
Aber ganz ehrlich: Unser kleines Paradies liegt weder zwischen Euphrat und Tigris, noch ist es ein Park, und dennoch, es ist – oder war (?) – unser Garten Eden, inmitten einer uns bekannten Landschaft, nicht weit von unserem vertrauten Zuhause entfernt und paradiesisch in mehr als nur parkartiger Hinsicht.
Da waren die Freitage, herrliche Tage, schulfrei ab Mittag bis zum kommenden Montag. Wir Jugendlichen waren frei, wenn wir in den Kajaks saßen mit dem Wochenendgepäck in den Booten.

Das Motiv stammt von der Intarsienarbeit auf der Theke des Vereinshauses des Kanuverein Unterweser Bremerhaven
Vom Bootshaus zunächst gegen den Tidenstrom bis zur Mole, der Hafeneinfahrt und der Mündung der Geeste in die Weser.
„De armen Lüt an Land“, riefen wir uns mit Blick auf die an der Mole stehenden Deichbesucher zu.
Dann auf dem hier breiten Strom der Wesermündung weiter mit der Flut stromaufwärts. Hinter uns die Silhouette der Seestadt Bremerhaven – unserer Stadt – der grauen Stadt am Meer, unserer Heimat. Damals noch ohne die weiße Hochhauskulisse des Columbus-Centers. Ohne die weißen „Schiffsbauten“ des Deutschen Schiffahrtsmuseums und des Alfred Wegener Institutes, die heute weit über die Deichkrone hinausragen. Nur die drei Hochhäuser an der Deichstraße nach der Entwicklungsplanung des Stadtplaners Ernst May und der Radarturm überragten schon damals weit die Silhouette der Stadt.
Hier an der Geestemündung öffnet sich die Weser zu ihrem großen Mündungstrichter – ist es noch Fluß oder schon Nordsee ? – Auf jeden Fall ist die Meeresnähe spürbar: Tide, Salz, Wind und Wellen und die Weite des Wassers, das sich wenigstens in Richtung Norden bis zum Horizont erstreckt.

Und mit der schier grenzenlosen Weite stellt sich das Gefühl der grenzenlosen Freiheit ein.
Der Mensch ist körperlich nicht zum Überleben im Meer ausgestattet. Um so bemerkenswerter ist die Tatsache, dass die Menschen immer wieder diese lebensfeindliche Umgebung freiwillig aufsuchen. Sie ist allerdings praktisch der letzte Bereich auf unserer Welt, wo noch Freiheit herrscht.
„Die See ist frei, Captain, wirklich frei, und jeder segelt auf ihr nach eigenem Willen die Kurse seiner Bestimmung“, beschreibt E.-J. Koch in „Hundeleben in Herrlichkeit“ 1968 das Gefühl, das auch wir empfinden bei unseren Kajaktouren in der Wesermündung. Zeitgleich sogar, denn damals begann meine Paddlerkarriere mit diesen Fahrten von Bremerhaven aus – 17-jährig und auf der Suche nach Selbsterfahrung – und nach Freiheit.
Auch wenn wir nicht im Segelboot auf den Weltmeeren unterwegs sind, aus der kleinen Nußschale des Kajaks erscheint die uns umgebende Weite des Wassers unendlich. Gleichförmig vielleicht für manchen, für uns ist es nur eine Einförmigkeit mit Variationen. Die fehlenden Ausweichmöglichkeiten bei Wellen, Wind und schlechtem Wetter führen zu neuer Selbsterfahrung:
„Die See umgibt uns mit Raum- und Zeitmaßen, die gewohnte Vorstellungen sprengen. Die See zwingt zu neuem Denken. Sie fordert den ganzen Einsatz unserer Körper- und Seelenkräfte“, schreibt Koch weiter 1968.
Aber er ist nicht der einzige, der in seinen Erzählungen auch unsere Empfindungen auf dem offenen Wasser genau trifft.
Moitessier beschreibt 1973 die „…See, Wind,…, Sonne, Wolken , Vögel,…, Frieden und Lebensfreude in Harmonie mit dem Weltall“ – pathetische Worte, die uns beim gleichmäßigen Paddelschlag bewegen, über die wir zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage sind zu sprechen, die uns aber bewußt werden, wenn der Alltag mit Schule, Lernen und den Alltagspflichten an Land wieder das Dasein bestimmen.
Aber noch fahren wir dem Wochenende entgegen.
Die Flußufer werden enger, die Möwen kommen von der Luneplate herübergeflogen.
„Hin gen Norden zieht die Möwe
Hin gen Norden zieht mein Herz,
fliegen beide mitsammen
fliegen beide heimatwärts.
Ruhig, Herz! Du bist zur Stelle,
flogst gar rasch die weitre Bahn –
und die Möwe schwebt noch rudernd
überm weiten Ozean.“
(Theodor Storm)
Die Luneplate erinnert uns an Schlammschlachten beim Anlanden, denn das Ufer ist schlickig, und die wenigen Male, bei denen die Fahrt hier beendet oder unterbrochen wurde, sind uns in leidvoller Erinnerung. Bis zum Oberschenkel versinkt man hier im dunklen Uferschlamm, auch jetzt ist das Wasser noch nicht hoch genug, um die Schlammbänke zu überspülen.
Heute ist die Luneplate zu großen Teilen Naturschutzgebiet und ungestörtes Revier der Austernfischer, Rotschenkel und Silbermöwen.
Am Fahrwasserrand liegt östlich von uns der Dalben, große Eisenpfähle im Wasser, an dem die Schiffe festmachen können. Für uns ist es ein Zeichen, dass wir die halbe Strecke geschafft haben. Die Tonnen am Fahrwasserrand haben sich schräg gelegt in der Strömung, die Flut hat uns fest im Griff und treibt uns mit guter Geschwindigkeit flußaufwärts.
Auf der anderen Flußseite ragen die langen Schornsteine der Industriegebiete Nordenhams in den Himmel. Früher hatten sie gelbe Fahnen und der Schwefelgeruch erfüllte beißend die Luft.
Zum Glück können wir heute freier atmen, die langen Schornsteine wirken wie Mahnmale der Industriegesellschaft. Lassen wir uns nicht täuschen: Trotz der durchgeführten Maßnahmen zur Verringerung der Luftbelastung ist die Verunreinigung immer noch immens hoch.
Einige Kilometer weiter hebt sich ein weiterer Zeitzeuge vor dem Horizont ab: das Atomkraftwerk Esensham. Es ist der Reaktor mit der weltweit längsten Betriebsdauer. Der kugelige Reaktorbau hat zwar seine eigene Ästhetik, aber das unheimliche Innenleben, die immer noch ungelösten Entsorgungsprobleme und Halbwertzeiten, die Jahrtausende umfassen, sind doch Grund genug für tiefgreifende Skepsis.
„Weißt Du, dass unter uns der Autoverkehr fließt?“ fragt der Freund. Wir überfahren mit dem Weserstrom den neuen Wesertunnel, der die Fähre Dedesdorf überflüssig gemacht hat. Die Fähranleger-Rampen enden ohne lebendiges Treiben und wie versunkene Straßen im Wasser.
Vor uns erhebt sich auf der Steuerbordseite die Kulisse der Strohauser Plate.
Hoch erhebt sich an der Inselspitze wie ein konisch zulaufendes großes, schwarzes Leitergerüst der Turm Strohausen Nord. Auf der kleinen Plattform hoch über dem Schilf haben früher die Krähen gebrütet. Wir sind hochgeklettert, konnten den Dunenjungen in die weit aufgerissenen Schnäbel schauen, während die Altvögel aufgeregt um den Turm kreisten. Der Turm steht inmitten der großen Schilfgebiete, welche den Nordteil der Plate bestimmen. Weit geht der Blick über die Flußlandschaft.
Früher waren es von hier aus noch etwa zwei Kilometer bis zu einem kleinen Platz – eine kleine Wiese zwischen Hundsrosenbüschen, Weiden und Kastanienbäumen.
Und schon keimt es wieder auf – die Erinnerung an unser sommerliches Paradies vor den Türen unserer Heimat: Der helle Strand auf dem sich bei Hochwasser direkt vor uns die Wellen rauschend brachen, wenn ein Frachter oder anderes Schiff den Strom befuhr. Oder der grüne Uferstreifen mit seinen kugeligen Büschen und Bäumen, dem schönen Platz unter den großen Weiden – wie eine kleine autarke Welt für sich inmitten der Schilf- und Weidelandschaft der Strohauser Plate. Wenn wir hier angekommen waren, war es unsere Welt, ein Ort, abgeschieden von allen Alltagssorgen.
Aber da waren auch die anderen Freunde dabei: mit Erfahrungen in der Außenweser und auf Kleinflüssen und einem Auto ! Für uns Jugendliche waren dieses alles noch ferne Träume – von denen wir zum Glück in den folgenden Jahren viele gemeinsam ausleben konnten.
Viele Erlebnisse haben sich tief ins Gedächtnis eingegraben, die Erfahrungen in dieser kleinen Welt haben uns geprägt.
Es gibt in meinen Tagebuchaufzeichnungen nur wenige Hinweise auf diese Touren, zu normal waren uns die Fahrten an den Wochenenden in unser kleines Paradies. Und dennoch gibt es um so mehr Erinnerungen an Lagerfeuer, Gruppenerlebnisse und Wasserspiele.
Oder die Abende: Schon damals in den 7o-iger Jahren war es für viele unserer gleichaltrigen Freunde etwas Seltenes, am Lagerfeuer zu sitzen und die stille Dunkelheit zu genießen.
„Und ich war verliebt in die Sterne, große, leuchtende Planeten und kleine Stecknadelköpfe, fette zwinkernde Himmelskörper, Massen, ja glitzernde Wolken von kleinen Pünktchen .. das ganze Himmelsgewölbe wie ein Lichtgewitter über meiner Insel“, beschreibt Paul Theroux in DIE GLÜCKLICHEN INSELN OZEANIENS das Erlebnis von Inselreisen per Kajak und trifft dabei auch unsere Gefühle.
Aber es waren nicht nur derartig romantische Themen, die uns heiße Diskussionen und laute Wortgefechte lieferten, schließlich erlebten wir um diese Zeit die Geburtswehen der Ökolögie! So saßen wir zusammen, am Strand, fühlten uns wohl in unserer Welt des freien Zusammenlebens. Die Zeichen dieser Zeit sind an den alten Fotos zu erkennen: lange Haare, Bärte. Aber unser kleines Paradies war die eine Seite, das, was wir aktuell diskutierten war die andere Seite: „Die Grenzen des Wachstums“ (Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit), „Müllplanet Erde“ (Hans Reimer) und „Das Selbstmord-Programm“ Zukunft oder Untergang der Menschheit (Gordon R. Taylor) – und schließlich lag das berühmte Orwell-Jahr 1984 noch vor uns! – Wer hat da nicht als gerade 20-jähriger philosophiert, diskutiert, prognostiziert und fantasiert.
Heute – mehr als 30 Jahre später – zeigt es sich: Es ist fast alles so eingetreten:
Die Umweltverschmutzung ist weitergegangen, auch wenn die Flüsse sauberer geworden sind. Die Umweltkatastrophen sind heute weltweit erlebbar und stehen fast täglich in den Medien an vorderster Stelle.
Die Orwell´sche Überwachung ist Dank Handy, Computerisierung und Terroristenverfolgungswahn tägliche Praxis!
Bernhard Moitessier kehrte 1969 von einer Non-Stop-Einhand-Weltumseglung nicht zurück, obwohl er kurz vor dem Ziel den Sieg mit hohem Geldpreis so gut wie sicher hatte. Das Erlebnis der Natur in den Weiten der Ozeane hatte ihn so verändert, dass er nicht in die Zivilisation zurückkehren konnte. Stattdessen segelte er noch einmal um die halbe Welt nach Tahiti.
Unser kleines Paradies lag für solch Ausreißer wohl zu dicht an der Wirklichkeit.
Aber es waren Atempausen aus dem Dunst des Alltags voll Energie und Sauerstoff – und sie sind es noch! Geblieben sind die Spuren im Paradies – bis zum nächsten Hochwasser.
Es ist ein schönes Erlebnis, den eigenen Kindern zu zeigen, wie man Sandburgen baut, Spuren im Schlick hinterläßt und Herzmuschelträume spinnt. Und es ist schön, nicht aus dem Paradies vertrieben zu werden – denn das unterscheidet uns (noch) von dem wahren Paradies der Bibel.