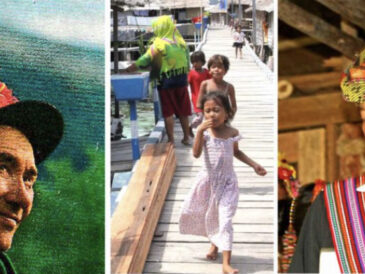Wieder sind wir unterwegs nach Süden. Unser Ziel: der Kaiserstuhl. Es ist das vierte Mal und langsam wird das Gebiet zu einem unserer Lieblingsziele in Deutschland. Aber eines haben wir uns zur Angewohnheit gemacht: Ein erster Zwischenstopp nach 200 km im Wonnegau. Schon der Name lässt Freude aufkommen. Das WeinArtLand Wonnegau im Süden von Rheinhessen im Bundesland Rheinland-Pfalz ist eine Hügel- und Weinlandschaft und der Ort Osthofen hat es uns mit seinen romantischen Weingasthof angetan.
Unter dem großen Blauglockenbaum in dem von Fachwerk- und niedrigen Gebäuden umgebenden Innenhof fühlen wir uns wohl. Wir verzichten auf die Besichtigung der Gedenkstätte des KZ Osthofen, eines der ersten staatlichen Konzentrationslager im Deutschen Reich.
Auch andere geschichtsträchtige Orte und Wege lassen sich hier finden: Es heißt, dass Martin Luther vor rund 500 Jahren den „Lutherweg“ hier auf seinem Pilgerweg von der Wartburg zum Reichstag nach Worms zurückgelegt hat. Auch die Hauptstrecke des Jakobspilgerweges führt über Westhofen nach Worms-Abenheim.
Aber das Wandern kommt für uns erst später an die Reihe. Dafür tauchen wir erst einmal ein in eine andere Geschichte der Region: „Rheinhessen ist mit über 26. 000 Hektar das größte Weinanbaugebiet Deutschlands“, lesen wir in der Bürgerbroschüre und so wird der Nachmittag im schönen Weingasthof zu einem besonderen Gaumen-Erlebnis mit Scheurebe und Schwarzriesling. Seit über unter 1300 Jahren werden in Osthofen Weinreben angebaut. Heute wachsen hier mehr als 2 Millionen Rebstöcke, die von den Winzern gepflegt und geerntet werden. Da sie dann zu herrlichem Wein veredelt werden, muss ich mich mit dem Studium zurückhalten, schließlich wollen wir morgen weiterfahren.
Die Route führt uns in Oberrheintal entlang vorbei am Pfälzerwald im Westen, bald östlich entlang des Schwarzwaldes. Dann tauchen vor uns neue Berge auf: der Kaiserstuhl.
Wir sind am südwestlichen Zipfel Deutschlands klimatisch in einer ganz besonderen Region. Ein Winzer in Achkarren hat es uns später so erklärt: Der häufige Westwind treibt die Wolken über die Vogesen. Dort steigen Sie auf und regnen sich ab. Wenn die Luft über die oberrheinische Tiefebene zieht, wärmt sie sich auf, die Wolken verschwinden und es wird sonnig. Erst der Schwarzwald stellt die nächste Barriere dar. So weist der Kaiserstuhl mit 1700 Sonnenstunden im Jahr die höchste Sonnenscheindauer in Deutschland auf und wird als eine „Wärmeinsel“ bezeichnet. Sind wir bei 14°C in Bonn losgefahren, so zeigt hier am Kaiserstuhl das Thermometer 24 Grad Celsius.
Wir tauchen ein in eine hügelige Kulturlandschaft und fühlen uns bald wie in einem großen Garten. Große Walnussbäume, mit roten Früchten beladene Kirschbäume und andere Obstbäume säumen den Weg. Purpur-roter Klatschmohn blüht üppig und übertönt mit seiner Farbenpracht die anderen vielfarbigen Blüten an den Straßen- und Feldrändern wie in einer großen Gartenlandschaft. Kurvenreiche Straßen schaffen immer wieder neue Blickwinkel, bis der Blick plötzlich eingeschränkt wird. Ein schmaler Hohlweg bei Bickensohl verengt die Sicht und gerade hier kommt uns ein großer Linienbus entgegen. Wir drücken uns vorsichtig an die Seite als er an uns vorbei rauscht. Die tief in den Lössboden eingefrästen Wege sind typisch für die Umgebung von Bickensohl. Die steilen Böschungen sind rot gefärbt von Klatschmohn – berauschende Wege. Auch das ist ein Grund weshalb wir schon bald unterwegs sind und zu Fuß geht es vom Parkplatz oberhalb von Achkarren bergauf vorbei an den Lösskanten hinauf zum Schneckenberg – ein herrlicher Blick über die Weinterrassen, über die Dächer von Achkarren bis zu den Bergen der Vogesen, über denen die Staffel der Wolken zu sehen ist. Es ist die besondere Ausstrahlung des Kaiserstuhls, die uns gefangen nimmt. Dabei ist es keine natürliche Umgebung, sondern eine Kulturlandschaft mit ihrem besonderen Charme.



Das Hupen des Wiedehopfes empfängt uns bald und über uns fliegen rufend einige Bienenfresser, während wir zwischen den Weinterrassen entlang gehen. Der blaublütige Natterkopf, gelbe Königskerzen, Steinklee und immer wieder der blutrote Klatschmohn bilden einen faszinierenden Blütenteppich an den Seitenhängen der Weinterrassen. Es raschelt und eine leuchtend grüne Smaragdeidechse huscht neben uns unter das Gewirr aus Gras, Blumen und Blattgrün. Nach neuen Erkenntnissen (K. Fritz, P. Sowig, Stuttgart 2007) handelt es sich um die westliche Art der Smaragdeidechsen. Ihr leuchtend grünes Paarungskleid mit der kornblumenblauen Kehle ist so berauschend schön, dass wir von nun an nur noch den Weg entlang schleichen, um mehr von diesen farbenprächtigen Tieren zu sehen.



Bald aber locken uns die Rufe der Vögel zu unseren Beobachtungsplätzen. Drei Wiedehopfe fliegen an einer alten eingewachsenen Hütte umher. Die Pfähle der Rebstöcke dienen als Sitzwarten, zum Putzen, Füttern und zur Hochzeit. Drei Tage lang beobachten wir die stattlichen Vögel, um sie nicht zu stören aus größerer Entfernung, aber mit langem Tele-Objektiv. Obwohl sich diese wärmeliebende Vogelart in Deutschland wieder ausbreitet, ist es immer für mich ein außergewöhnliches Beobachtungserlebnis, das in diese fast mystische Gartenlandschaft hineinpasst. Es mag an der auffälligen Gestalt des Wiedehopfes liegen, dass er schon sehr früh in Schriftstücken, in der Musik und in der Religion besonders hervorgehoben wurde.
So ist der Wiedehopf der König der Vögel in dem griechischen Theaterstück „Die Vögel“ von Aristophanes, erstmals aufgeführt 414 vor Christi, welches die Machtergreifung der Vögel darstellt. Auch im Koran wird der Wiedehopf als Boote zwischen Sulaiman (Salomo) und der Königin von Saba genannt. Diese Erwähnung führte zu einer besonderen Wertschätzung in islamischen Ländern. Im Persischen hat er auch den Namen Salomonvogel erhalten.
Auch Joseph von Eichendorff dichtete in seinem „Leben eines Taugenichts“:
„Wenn der Hoppevogel schreit
ist der Tag nicht mehr weit.
Wenn die Sonne sich auf thut,
schmeckt der Schlaf noch so gut!“
Und im Mai 1967 sang Sandie Shaw in der deutschen Version des Liedes „Puppet on a string“:
„Wenn du wieder kommst,
dann sing ich,
dann spring ich zur Tür
wie ein Wiedehopf im Mai“.









Aber eigentlich sind wir in dieses Gartenparadies wegen eines anderen besonderen Vogels gekommen. Die wahren „Paradiesvögel“ hier sind die Bienenfresser. In ihrem bunten Federkleid gehören sie zu den farbenprächtigsten Vögeln in Europa. Als Höhlenbrüter benötigen sie die hier so zahlreich vorkommenden Lösskanten, in die sie zwei bis drei Wochen lang vier bis fünf Zentimeter große Höhlen bis 1, 50 m tief hineingraben. Da sie erst Mitte Mai aus ihren Winterquartieren in Afrika in ihre Brutgebiete kommen, können wir sie jetzt Anfang Juni aktiv über den Rebflächen hin und her fliegen sehen. Ihr heiser klingendes „Purr“ und „Kruk…kruk“ klingt über uns. Als gute Flieger sind sie auf Insektenjagd. Um nicht von den oft wehrhaften großen Insekten beim Verschlucken gestochen zu werden, landen sie regelmäßig auf einer exponierten Sitzwarte und kneten mit kräftigen Hieben die Giftdrüsen und Stachel aus den Bienen, Hornissen, Hummeln oder schlagen die Flügel der Schmetterlinge und Libellen schnabelgerecht ab. Als Koloniebrüter sind sie nie alleine und so ist es ein buntes Treiben über und vor uns. Wir sind dieses Mal vom Friedhof in Ihringen gestartet. Zu Fuß geht es zu einem kleinen Beobachtungsstand. Die Brutwand ist relativ weit entfernt, aber es gibt einige hohe Bäume mit kahlen Ästen, die sich offenbar als Sitzwarten hervorragend eignen. In sicherer Entfernung baue ich Stativ und Teleobjektiv auf und kann sie so bei der Übergabe der Brautgeschenke, bei der Hochzeit und Gefiederpflege beobachten. Bei dem hellen Sonnenschein leuchten die gelben, blauen und braunen Gefiederfarben so sehr, dass es für mich durch das starke Teleobjektiv zu einem reinen Farbrausch wird.
In der frühen Jugend war es für mich ein Wunschtraum diese „fliegenden Edelsteine“ kennenzulernen, die ich in dem Buch „Wunderwelt der wilden Vögel“ über die Tierwelt der Camargue entdeckt hatte. Bis Ende des der 1980er Jahre galt diese Art in Deutschland als ausgestorben. Erst seit 1990 ist er wieder nach Deutschland gekommen und zum Beginn des 21. Jahrhunderts im Kaiserstuhl erstmals nachgewiesen. So kann ich hier einen meiner Jugendträume erfüllen. Nicht eingeklemmt zwischen ein paar Buchseiten, sondern im Sonnenschein direkt vor mir es ist ein Glücksgefühl, wenn sich Träume erfüllen.






Aber zu den hervorragenden Merkmalen des Kaiserstuhls zählen nicht nur die Vögel. Zwar wurde der Kaiserstuhl seit 2007 mit Verordnung von 5.2.2010 zum Europäischen Vogelschutzgebiet erklärt und ist mit seinem Bienenfressern, Wiedehopfen, Baumfalken, Schwarzkehlchen, Zaunammern, Wendehals…. insgesamt 80 Vogelarten eine hervorragende ornithologische Erlebniswelt. Bekannt war das Gebiet aber schon vorher: Als Highlight für Botaniker und Orchideenfreunde. Die klimatische Situation der „Wärmeinsel“ liefert die Voraussetzung für besondere Biotope.

Nur einen Kilometer von Achkarren entfernt liegt am westlichen Ende des Kaiserstuhls das Naturschutzgebiet Büchsenberg. Mit 284 m Höhe erhebt sich der Büchsenberg zwar nur gemäßigt über den Ort Achkarren, der auf 230 m Höhe liegt. Dennoch geht es für uns wieder an der Westflanke steil bergan. Zwei Smaragdeidechsen huschen am Wegesrand vor uns ins Gebüsch. Bald hören wir auch Bienenfresser über uns. Immer weiter geht es bergan zum Büchsenberg hinauf. Links liegt der Wald. Es ist ein Flaumeichen-Laubmischwald. Die Flaumeiche kommt nur noch an wenigen Standorten in Deutschland vor. Sie ist ein Überbleibsel der Wärmeperiode nach der letzten Eiszeit und wächst nur in warmem Klima. In den Waldlichtungen haben wir bei unserem Besuch im vergangenen Jahr hier massenhaft die meterhohen Stauden des Diptam gesehen. Die weiß-rot gemaserten Blütenstände verwandeln den Hang in ein leuchtendes Blütenmeer. Dafür ist es jetzt zu spät, die Blütezeit ist längst vorbei. Aber ich entdecke eine andere bemerkenswerte Pflanze. Die giftigen aufgeblasenen Schoten des Blasenstrauchs fallen uns am Rande des trockenen Eichenwaldes ins Auge. Wir entdecken zwar keine der gelben Schmetterlingsblüten, aber dafür hängen die Büsche voller 6 bis 8 cm großer blasig aufgetriebenen Hülsenfrüchte. Die Hülsenfrüchte, die im Inneren bist du 30 Samen enthalten, werden bei Reife aufgrund der pergamentartigen gasundurchlässigen Fruchtwand durch Kohlendioxid-Bildung ballonartig aufgeblasen. Diese interessante Pflanze gibt es wild nur im Oberrheingebiet – kein Wunder also, dass wir sie bisher noch nicht gesehen haben.


Aufgrund der klimatischen Situation gibt es am Kaiserstuhl ein weiteres Gebiet, das wir besichtigen: Es ist das Gebiet des Badberges. Direkt vom Parkplatz kurz hinter Oberbergen geht es wieder steil aufwärts zwischen den Rebfeldern hindurch. Schon bald werden wir durch tolle Ausblicke belohnt und die kleinen Böschungen und Wegränder sind voller bunter Wildblumen. Oberhalb der Rebflächen gibt es einen der größten Halbtrockenrasen Deutschlands und der ist voller bunter Blumen: Die aufgerichteten Äste der Rapunzel-Glockenblume, die rundblättrige Glockenblume, das gelbe Tüpfel-Hartheus (Johanniskraut), der einjährige Feinstrahl und die Wiesenflockenblume. Besonders auffällig und häufig sind die hohen Blütenstände des blauen Natterkopfes und die gelben Blütenstände der Königskerzen.




Auch Orchideen entdecken wir. Von den in Deutschland vorkommenden 55 Orchideenarten sollen im Kaiserstuhl 33 Arten vorkommen. Viele Arten sind schon verblüht wie z. B einige Knabenkrautarten und auch die Fliegenragwurz. Aber einige entdecken wir noch: Bei den Ragwurzarten begeistern uns noch viele Hummelragwurze und auch die Bienenragwurz entdecken wir für uns erstmals. Bocks-Riemenzunge und Pyramidenknabenkraut und Großes Zweiblatt, auch Ohnhorn mit seiner Blüte „wie ein hängender Mensch“ kommt im Kaiserstuhl vor. Die besondere Gestalt der Blüten hat zu niedlichen mundartlichen Namen geführt „Herrgottsbärtli“ (Fliegenragwurz), „Sammetwibli“ und „Sammetmannli“ (Ohnhorn). Diese Namen zeigen auch die positive Einstellung der Menschen zu ihrer Natur.










Viele Insekten umschwirren die Blüten, auch Schmetterlinge wie Bläuling und Schachbrettfalter sind zu sehen. Nur Gottesanbeter-Fangschrecken entdecken wir nicht.
Es ist die Ausstrahlung dieser großen Halbtrockenrasenflächen, die uns fasziniert. Die bunten Blumen vermitteln die harmonische Fröhlichkeit eines Brautstraußes, der sanft auf den Bergkuppen liegt. Sind wir hier angekommen wie in einem Garten Eden? Es ist wohl das üppige Zusammenspiel der bunten Blütenvielfalt, der Weinreben in Überzahl und der einzigartigen Vogel- und Tierwelt, die hier das Gespür aufkommen lässt, in einem großen Garten Eden zu sein.




Der Begriff „Eden“ geht auf das gleich lautende hebräischen Wort zurück und bedeutet „Wonne“ oder „Wonneland“ und ein Gespür für Wonne führt uns wohl zehnmal vorbei und immer wieder hinein in … die Wonne-Bereiche für unsere Sinne: Es gibt so viele Winzer und Genossenschaften in den Kaiserstühler Weinorten, bei denen die Sinne übermütig werden können. Es liegt wohl auch an dem Realerbteilungsrecht am Kaiserstuhl, bei dem der Landbesitzt unter den Erbberechtigten gleich aufgeteilt wird. So entstanden sehr viele kleine Parzellen, die heute meist im Nebenerwerb bewirtschaftet werden. Es überrascht deshalb nicht, dass es am Kaiserstuhl und Tunisberg über 100 Weingüter und Weingenossenschaften gibt – die Versuchung zur Weinprobe lauert an jeder Ecke. Und wie wir uns gerne in Versuchung führen lassen… Von den rund 140 Rebsorten, die in Deutschland angebaut werden, beherrschen nur ca. 30 Rebsorten den Markt in Deutschland. Am Kaiserstuhl sind es vor allem Riesling, Müller-Thurgau, Grauburgunder und roter Spätburgunder.
Bei einer Führung durch die Weinkeller der Weingenossenschaft Achkarren führt uns der Winzer in die Vergangenheit und Gegenwart des Weinanbaus am Kaiserstuhl ein. Wie soll ich eine zweistündige Führung durch Verkaufshallen, Pressmaschinenhallen, Gär- und Lagerungsfass-„Weindome“ bis zum Heiligtum der Lagerung alter Weine der ca. 100-jährigen Genossenschaftsgeschichte in ein paar wenigen Sätzen zusammenfassen? Die Fässer und Tanks aus Eichenholz, Edelstahl bis 22.500 Liter Fassung oder Beton mit einem Fassungsvermögen bis 52 000 Liter haben immer nur ein kleines Mann-Loch, durch das der Winzer zur Fassreinigung hinein kriechen muss. Es ist eine Horrorvorstellung nicht nur für Anke.





Mit etwas größere Ehrfurcht benetzten wir an den nächsten Tagen Zunge und Gaumen mit den edlen Tropfen. Es ist nicht der Riesling der uns hier reizt, dafür haben wir unseren Winzerfreund an der Mosel. Am Kaiserstuhl probieren wir andere Weinsorten: Chardonay, Gewürztraminer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Silvaner und Rivaner. Besonders angetan bin ich vom Auxerrois, einer Neuzüchtung ähnlich Weißburgunder, aber bouquetreicher, fruchtiger mit weniger Säure.
Mit schwer beladenem Wagen geht es wieder zurück nach Bonn, aber das Gespür für Wonne bleibt, wenn wir an den Kaiserstuhl denken, an seine paradiesischen Vögel, Tiere und Pflanzen und wenn wir im Wein die Vulkan- und Lössgeschichte schmecken.